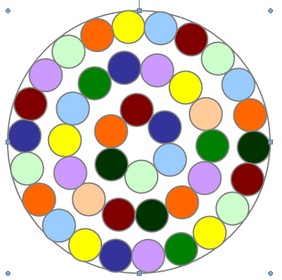Es könnte so schön sein: Alle Kinder lernen in der Schule und machen gemeinsam Lernerfahrungen – unabhängig davon, welcher Nation ihre Eltern angehören, aus welcher sozialen Schicht sie kommen oder ob sie körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Die Kinder eines Jahrgangs lernen im gleichen Raum, aber auf unterschiedlichen Niveaus und erfahren sich trotzdem als Gemeinschaft. Neben einer Lehrkraft gibt es eine unterstützende Person, die mit darauf achtet, dass alle gut lernen können.
Was sich für deutsche Ohren anhört wie ein Märchen aus 1001 Nacht, ist an anderen Orten gängiger Alltag, dies kann vor allem in den nordischen Ländern bestaunt werden. Dagegen wirkt die Diskussion in Deutschland seltsam verzagt und bei allen Beteiligten steigt der Frust, weil es den einen zu schnell geht und den anderen zu langsam – oder auch, weil manche ein Ziel verfolgen sollen, das sie gar nicht teilen. Was also läuft falsch bei Deutschlands Inklusionsbemühungen?
Inklusion ist oft nicht gewollt
Machen wir uns nichts vor: Der Beitritt Deutschlands zur Behindertenrechtskonvention hat einen top-down-Prozess zur Folge. Der Bundestag hat der Konvention zugestimmt und damit auch dem Gebot, dass Kinder aufgrund ihrer Behinderung nicht diskriminiert werden und gemeinsam mit anderen unterrichtet werden sollen. Würden das vielleicht abstrakt noch viele unterschreiben, wird die Akzeptanz umso brüchiger, je konkreter die Sache wird. Meine persönliche und pessimistische These: Inklusion wird dann befürwortet, wenn sie keine Veränderungen im eigenen Bereich nach sich zieht.
Alle sagen Inklusion – meinen aber was Verschiedenes!
Der Begriff der Inklusion ist in aller Munde. Er will sagen: Die Institutionen in der Gesellschaft werden so gestaltet, dass ALLE daran partizipieren können. Das meint Menschen mit Behinderung, aber beileibe nicht nur. Und das bedeutet: Inklusion richtet sich an Institutionen, die sich ändern müssen! Das bedeutet nicht: Menschen mit Einschränkungen müssen dahin gebracht werden, dass sie den Anforderungen der Institution gerecht werden. Das kann man revolutionär nennen.
Für den Bereich Schule, der ja in der Diskussion im Mittelpunkt steht, heißt das: Es gibt nicht mehr „Integrationskinder“, die an den Schulalltag herangeführt werden müssen und es gibt schon gar keine „Inklusionskinder“, denn Inklusion richtet sich ja an die Schulen. Umgestaltet werden die Schulen, die so gestaltet werden, dass alle Kinder dort gemeinsam lernen können. Das hört sich einfach an, ist aber eine Herkulesaufgabe, die Jahrzehnte dauern wird. Und dazu wird kein Beitrag geleistet, wenn einfach das Wort „Integration“ durch das Wort „Inklusion“ ersetzt wird (also aus „Einzelintegration“ das Ungetüm „Einzelinklusion“ gemacht wird).
Damit wird aber auch klar: Inklusion ist nicht die Aufgabe und auch nicht im Hauptinteresse von Eltern von Kindern mit Behinderung, sondern ist ein Thema, das alle angeht. Denn es geht darum, die Bildungschancen von allen Kindern zu erhöhen und damit nichts weniger als eine gute Zukunft für unser Land zu ermöglichen, um es pathetisch auszudrücken. Und ja, das wird auch Geld kosten, da dafür mehr Lehrkräfte und mehr Mittel für die Unterstützung von einzelnen Kindern nötig sein werden.
Und ganz hart: Segregation und Inklusion gehen nicht zusammen!
Die Größe der Aufgabe einer inklusiven Schule zeigt sich gerade für Länder wie Bayern und Baden-Württemberg auch darin, dass es einen inneren Widerspruch zwischen Inklusion und Segregation gibt. Man kann nicht antreten, eine Schule für alle zu machen und dann z.B. nach der vierten Klasse die Mädchen und Jungen in verschiedene Schularten aufteilen. Das ist auch schon in der Praxis zu spüren. Oft berichten Lehrerinnen und Lehrer, dass der gemeinsame Unterricht bis in die dritte Klasse hinein funktioniere, dann der Unterschied zu groß werde. Hinderlich sei aber vor allem, dass dann das Thema Übertritt so dominant werde, und der Druck so steige, dass die Kinder mit Handicaps nicht mehr mitgenommen werden könnten. Immer wieder intervenierten Eltern von „normalen“ Kindern, die Angst hätten, ihre Kinder würden ausgebremst, da die Kinder mit Behinderung zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden.
Das Tröstliche: Man muss inklusive Schulen nicht erfinden, man kann auch einfach von anderen Ländern profitieren, die da schon viel weiter sind. Eine Referentin aus Schweden bringt das wie folgt auf den Punkt: „Wenn ich in Schweden einen Vortrag über inklusive Schule halte, fragen alle, was ich eigentlich sagen wolle – machen wir ja schon. Beim gleichen Vortrag in Deutschland kommt oft die Reaktion: Hört sich ja gut an, ist aber leider völlig unrealistisch!“
Deshalb gilt: Will Deutschland wirklich der Behindertenrechtskonvention entsprechen, wozu es verpflichtet wäre, muss größer und grundsätzlicher gedacht werden. Das im Kleinen zu versuchen, geht oft zu Lasten der Kinder und erzeugt mehr Frustration als Nutzen. Und nur mit grundlegenden Reformen kann ein Schulsystem gefunden werden, das allen gerecht wird und damit zu besseren Ergebnissen kommt als das heutige! Aber: Wir müssen es auch wollen. Wirklich!
Disclaimer: Dieser Kommentar wurde zuerst auf dem Blog Familien in Stuttgart veröffentlicht: familien-in-stuttgart.de